„Die Erinnerung an Migrationsgeschichten lebt weiter“

Frau Freitag, Sie haben sich 15 Jahre lang mit der Geschichte der Stadt Dschidda im heutigen Saudi-Arabien beschäftigt. Dabei gab es bedeutsamere Städte im Osmanischen Reich. Warum Dschidda?
Ulrike Freitag: Dschidda hatte lange eine Scharnierfunktion im Handel zwischen der Mittelmeerregion und dem Indischen Ozean. Anhand von Dschidda im 19. und frühen 20. Jahrhundert habe ich mir eine frühe Phase der Globalisierung angesehen, auch über die Stadt hinaus. In Dschidda kann man unterschiedlichste Einflüsse beobachten, was sich heute noch im Charakter der Stadt widerspiegelt. In Dschidda sagt man dschidda gheir, Dschidda ist anders.
Dieser Slogan bildet eine Art Rahmen für Ihr Buch „A History of Jeddah“. Inwiefern ist die Stadt anders? Und anders als welche Städte?
Freitag: Dschidda war und ist anders als andere saudische Städte, weil die Bevölkerung aus aller Welt stammt, aus Indien, Ägypten, Iran, Marokko und anderen Regionen. Das sieht man an der Esskultur, es zeigt sich aber auch in einer Offenheit, die zwar typisch ist für Hafenstädte, aber im saudischen Kontext besonders auffällt – vor allem im Vergleich zur Hauptstadt Riad und anderen eher beduinisch geprägten Städten Saudi-Arabiens.
Der Westen Saudi-Arabiens war Teil des Osmanischen Reichs. Erst seit den 1920er Jahren stand Dschidda unter saudischer Herrschaft. Womit identifizierte man sich in der Stadt?
Freitag: Wie überall im Osmanischen Reich war eine osmanische Identität nur ein Elitenphänomen. In Dschidda verstehen sich heute die meisten, die sich für Mitglieder alter Familien halten, als saudisch. Es lebt aber – durch Familiennamen, aber auch durch bestimmte Familientraditionen – die Erinnerung an Migrationsgeschichten weiter. Sie werden sehr bewusst als Teil einer sich multikulturell verstehenden Stadtidentität gepflegt.
Die arabische Abstammung spielt also eine untergeordnete Rolle, obwohl Dschidda unweit der heiligen Städte Mekka und Medina liegt?
Freitag: Einerseits wird der historische Multikulturalismus gepriesen, andererseits wird darauf hingewiesen, dass man, selbst wenn man aus Indien oder Iran kommt, ursprünglich arabische Wurzeln habe. Das ist Teil eines Trends, der auch anderswo auf der Arabischen Halbinsel zu beobachten ist. Man betont das Arabertum und versucht, einen Bezug zu wichtigen Stämmen herzustellen, eine genealogische Linie zu ziehen.
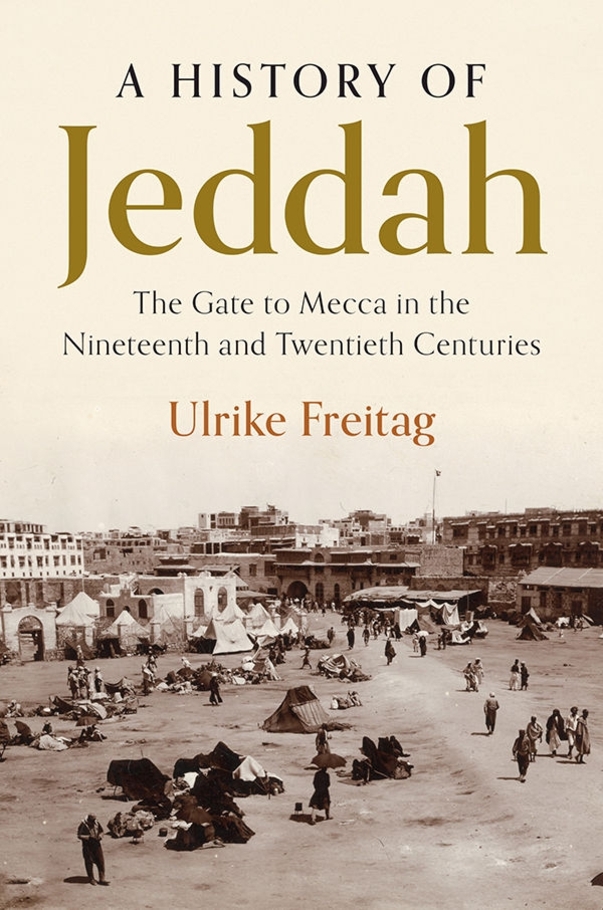
Ist das nicht ein Widerspruch? Multikulturalismus und gleichzeitig die Betonung des Arabertums?
Freitag: Viele alte Familien in Dschidda sagen, sie kämen ursprünglich von der Halbinsel, hätten über hunderte von Jahren die Welt gesehen und seien schließlich zurückgekehrt. Das ist einerseits eine Anpassung an den erwähnten Trend zum Arabertum. Andererseits ist es eine Verteidigung gegen den Vorwurf, nur ein Überbleibsel der Pilgerfahrt nach Mekka zu sein und keine lokalen Wurzeln zu haben. Für die Einwohner Dschiddas gibt es die Bezeichnungen turschat al-bahr (Auswurf des Meeres) oder baqayat al-hadsch (Reste der Hadsch). Insofern ist die Genealogie auch eine Strategie, sich einen Platz in der saudischen Gesellschaft zu sichern.
Was ist gemeint mit „Reste der Hadsch“?
Freitag: Neben dem Handel hat vor allem die Pilgerfahrt nach Mekka, die Hadsch, die Stadt geprägt. Laut Gründungsmythos hat Uthman, der dritte islamische Kalif, die Stadt zum Hafen Mekkas erklärt. Mit zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen und dem Aufkommen der Dampfschifffahrt im 19. Jahrhundert sind die Pilger mehr noch als vorher übers Meer gekommen und in Dschidda an Land gegangen. Das hat zum multikulturellen Charakter der Stadt beigetragen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass das Rote Meer sehr schmal ist. Es gab schon früh Verbindungen in den Sudan und an das Horn von Afrika. Von dort kamen Pilger, aber auch Arbeitsmigranten. Und natürlich hat auch der massive Sklavenhandel die Stadt geprägt.
Von der Sklaverei zur Arbeitsmigration
Sie schreiben, dass Sklavinnen und Sklaven in den 1880er Jahren ein Fünftel der Stadtbevölkerung von Dschidda ausmachten. Welche Rolle spielten sie?
Freitag: Wenn man bösartig ist, könnte man sie ein Stück weit vergleichen mit den migrantischen Arbeitskräften heute. Ein Großteil der Hausarbeit in den reichen Familien wurde damals von Sklaven erledigt. Die Arbeit am Hafen, das Verladen der Pakete, das Rudern der kleinen Boote, das Tragen der Ware vom Hafen durch den Zoll bis in die Lager, all das wurde von Sklaven erledigt.
Waren das alles Männer?
Freitag: Nein, die Haussklaven waren meist Frauen. Wäsche waschen, Wasser holen, Mahlzeiten für die Pilger zubereiten: Das waren eine ganze Reihe typisch weiblicher Sklavenarbeiten. Viele Sklavinnen sind zu Konkubinen geworden und haben Kinder bekommen, die dann als gleichberechtigte Abkömmlinge der freien Männer galten, etwa mit gleichem Erbrecht. Die Nachkommen der Sklavinnen sind dadurch Teil der lokalen Bevölkerung geworden.
Heutigen Arbeitsmigrantinnen ist das kaum möglich.
Freitag: Das ist eine völlig andere Konstruktion. Die Gastarbeiter sind nur temporär da, wohingegen Sklaven zwar weiterverkauft werden konnten, im Prinzip aber zum Haushalt gehörten. Ihre Kinder wuchsen mit den einheimischen Kindern auf, während die Kinder von Gastarbeitern heute auf getrennte Schulen gehen. Wenn heute eine Hausangestellte ein Kind von einem Saudi bekommt, wird sie, wenn sie Glück hat, direkt nach Hause zurückgeschickt, während sie damals fest zum Haushalt gehört hätte.
War das ein Vorteil?
Freitag: Wenn Kinder da waren, wurden die Mütter im besten Fall freigesprochen. In der Regel jedoch wurden sie nicht mehr weiterverkauft und hatten dadurch zumindest eine gewisse soziale Sicherheit. Die Sklavinnen hatten ja keinerlei eigene Familie, die sie unterstützen konnte, sondern waren darauf angewiesen, hilfreiche soziale Beziehungen aufzubauen. Durch Verkauf wurden diese Beziehungen immer wieder unterbrochen, so dass die Frauen stärker Gewalt und Missbrauch ausgesetzt waren. Da gibt es schreckliche Schicksale. Eine ehemalige Sklavin sagte mir im Interview, dass für sie entscheidend war, dass sie nicht mehr verkauft und aus ihrem Kontext gerissen werden konnte.
Die Sklaverei wurde in Saudi-Arabien erst 1962 abgeschafft. Leben die ehemaligen Sklaven weiterhin im Land?
Freitag: Ja, wo hätten sie auch hingehen sollen? Sie haben in der Regel die Namen der Familien, für die sie gearbeitet haben, angenommen und sind in deren Diensten geblieben. Heute gehören sie oft noch zum weiteren Umkreis bestimmter Notabeln oder Prinzen aus der Königsfamilie. Bei offiziellen Delegationen lässt sich das beobachten: Unter ihnen finden sich oft deutlich dunkelhäutigere Personen. Das sind meist ehemalige Sklaven, die weiter eng mit einer führenden Familie verbunden sind.
Die ehemaligen Sklaven sind also weiter abhängig?
Freitag: Nicht unbedingt, es gibt auch einzelne Fälle, in denen ehemalige Sklaven oder deren Kinder das Familiengeschäft übernommen haben. Das waren aber die glücklichen Ausnahmen.Gibt es eine gesellschaftliche Debatte über die Sklaverei?
Freitag: Ich habe keine kritische Aufarbeitung der Sklaverei mitbekommen, wie sie jetzt beispielsweise in der Türkei anfängt. Es gibt Romane, die das Thema aufgreifen, aber keine gewissermaßen postkoloniale Debatte in Saudi-Arabien dazu.

Mitte der 1920er Jahre übernahmen die saudischen Herrscher die Kontrolle über die heiligen Stätten und über Dschidda. Was machte das mit der Stadt?
Freitag: Es gab kulturelle Veränderungen. Prostitution, Alkoholgenuss und Musik, die wie in jeder Hafenstadt gang und gäbe waren, wurden verboten. Auch fand ein religiöser Wandel statt. Die Saudis folgten der wahhabitischen Interpretation des Islam. Das bedeutete eine rigide Religionsauslegung, die insbesondere jeglichen Heilgenkult ablehnte. Das Grab von Eva außerhalb von Dschidda wurde zum Beispiel zerstört. Trotzdem wird es bis heute von Pilgern besucht. Auch der Sufismus, der die religiösen Praktiken in der Stadt stark geprägt hatte, wurde bekämpft.
Ihr Buch ist äußerst detailreich, Sie schreiben über Sportwettkämpfe, frühen Hooliganismus und einen Frauenkarneval in Dschidda. Wie haben Sie recherchiert?
Freitag: Ich habe viel aus britischen und französischen Konsularquellen geschöpft sowie osmanische und arabische Quellen verwendet. Ich habe historische Zeitungen ausgewertet und versucht, lokale Familiengeschichten zu finden, die teils privat verlegt wurden und nur in Familienzirkeln kursieren. Außerdem gibt es eine Erinnerungsliteratur, die sich in verschiedenen Zeitungen niedergeschlagen hat. Schwierig war es, Zugang zu Dokumenten der Stadtverwaltung oder zu lokalen Gerichts- und Polizeidokumenten zu bekommen, die ja häufig viel über das soziale Leben einer Stadt sagen.
Wie kommt man als Historikerin an eine nicht veröffentlichte Familiengeschichte?
Freitag: Nach dem Schneeballprinzip: Ich habe anfangs herumgefragt, wer jemanden aus den wichtigen Familien kennt, und wurde dann sehr schnell weitergereicht an Menschen, die etwas erzählen konnten. Wenn man das lang genug betreibt, kommt man an viele Familien heran. Außerdem habe ich einige öffentliche Vorträge in Dschidda gehalten, was mir weitere Kontakte verschafft hat.
Sind Sie als europäische Wissenschaftlerin auf Skepsis gestoßen?
Freitag: Es gibt immer Menschen, die nicht auf Mails oder Anrufe antworten. Dann muss man davon ausgehen, dass sie nicht begeistert sind, wenn sich ein Ausländer mit ihrer Stadt beschäftigt. Aber in der Regel waren die Familien ausgesprochen hilfreich und haben mir, wenn es Familienliteratur gab, diese sehr gern weitergegeben. Mit der Stadtverwaltung war es schwieriger.
Der von Ihnen untersuchte Zeitraum endet 1947, als die Stadtmauer von Dschidda abgerissen wurde. Sind denn die Pilgerfahrt und der Handel heute immer noch so prägend für die Stadt?
Freitag: Dschidda ist immer noch ein wichtiger Hafen, aber er hat keine so zentrale Funktion mehr wie früher. Es gibt auf der Arabischen Halbinsel inzwischen wichtigere Containerhäfen. Was die Pilgerfahrt nach Mekka anbelangt, ist heute der Flughafen von Dschidda das Eingangstor ins Land für die Pilger. Viele bleiben nach der Hadsch noch länger im Land, vor allem in Dschidda. Das versucht man jetzt auszubauen unter dem Stichwort 'religiöser Tourismus', der eine Grundsäule der 'Vision 2030' von Kronprinz Mohammed bin Salman darstellt.
Interview: Jannis Hagmann
© Qantara.de 2020
Prof. Dr. Ulrike Freitag ist Nahost-Historikerin und Direktorin des Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin. Ihr Buch „A History of Jeddah. The Gate to Mecca in the Nineteenth and Twentieth Centuries“ ist bei Cambridge University Press im Februar 2020 erschienen.