Laute Islamkritiker, leise Islamversteher

Vier Wissenschaftler und eine Journalistin sprachen Anfang April bei einer Podiumsdiskussion des Leibniz-Zentrums Moderner Orient (ZMO) in Berlin über das Verhältnis von Forschung und öffentlichen Debatten. Auch weitere Fragen wurden diskutiert: „Wie entstehen Islambilder? Gibt es überhaupt „eine islamische Welt“? Und wie kann man über Muslime differenziert und kritisch sprechen, ohne dass durch Pauschalisierungen zu grobe Bilder entstehen?
Diese Fragen sind aktueller denn je. Denn wohl noch nie standen die Themen Islam und Muslime so sehr im Mittelpunkt der – oft polemisch geführten – politischen Debatten in Deutschland und Europa wie heute.
Nicht selten werden die Debatten dabei von Vorurteilen und Ängsten beherrscht, ausgelöst durch die Flucht von rund 800.000 Menschen überwiegend aus den Kriegsgebieten Syriens und Afghanistans nach Deutschland. Rechtspopulistische Bewegungen und Parteien stellen das Thema bewusst ins Zentrum ihrer Propaganda. Ist da überhaupt noch Platz für Differenzierungen?
Das Leibniz-Zentrum Moderner Orient ist will einen Raum für Differenzierung bieten. 1996 wurde das Zentrum als außeruniversitäres Forschungsinstitut gegründet.
Seit 1998 ist es im beschaulichen Berliner Ortsteil Nikolassee angesiedelt und seit 2017 Teil der Leibniz-Gemeinschaft. Mit dem Namen fängt die Problematik bereits an: Was soll denn überhaupt der Orient sein? Schon der Begriff selbst ist Gegenstand der Kritik, spätestens seit Edward Saids grundlegendem Werk über den „Orientalismus“, das stereotype westliche Darstellungen des Orients dekonstruiert. Und was genau ist die Moderne? Ist die nicht längst vorbei?
Da sind wir schon mittendrin in der Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert. Forschung hinterfragt sich notwendigerweise ständig selbst und gerade den progressiveren, interdisziplinären und interkulturell orientierten Forschern ist das universitäre Scheuklappendenken der Vergangenheit ein Gräuel.
Auch am ZMO (am liebsten in der Abkürzung benutzt, so braucht man sich mit den problematischen Begriffen nicht herumzuschlagen) will man keinen Eurozentrismus. Hier leben und forschen Gastwissenschaftler aus der ganzen Welt, die innovative Forschungsfragen zu islamisch geprägten Kulturen jenseits aller geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachgrenzen bearbeiten.

Im Differenzierungsnebel
Dabei geht es keineswegs nur um den Nahen Osten. Aktuelle Projekte widmen sich unter anderem dem Thema „Sport und Moderne in Äthiopien“ (Katrin Bromber), der „Religiösen Praxis unter muslimischen Jugendlichen in Niger“ (Abdoulaye Sounaye) oder dem „Politischen Denken an der Universität Kabul“ (Kyara Klausmann). Die Publikationsreihe behandelt historische Themen, die nicht selten einen klaren Gegenwartsbezug haben.
So haben Israel Gershoni und Götz Nordbruch zum Beispiel in „Sympathie und Schrecken - Begegnungen mit Faschismus und Nationalsozialismus in Ägypten, 1922–1937“ gezeigt, dass ein großer Teil der ägyptischen Öffentlichkeit die autoritären Herrschaftspraktiken und die Verfolgung von Juden und anderen Opfergruppen in Italien und Deutschland entschieden ablehnte. Ein überraschender Befund angesichts der Selbstverständlichkeit, mit der heute die Verbreitung antisemitischer Überzeugungen in der arabischen Welt wahrgenommen wird.
Das ist Grundlagenforschung im besten Sinne. Einseitige Zuschreibungen will man hier vermeiden: besonders die gröbste Verallgemeinerung auf „den Islam“. Aber auch die Verwendung der Begriffe „islamisch“, „muslimisch“ und „Muslime“ könnte schon zu grobe Kategorien schaffen, durch die der Blick auf andere Aspekte der Analyse verstellt wird.
Solche Zuschreibungen verstärken sich, wenn man über „muslimische Zuwanderer“ oder über den „islamischen Terrorismus“ spricht. Wer, so merken die Forscher an, analysiert schon europäische Politik als Teil der „christlichen Welt“?
Mit „islamischer Welt“ werde zudem viel zu oft der Nahe Osten bezeichnet. Islam und Muslime sind aber nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Schon gar nicht an die arabische Welt, wo der Islam zwar seinen Ursprung hat, über den er jedoch schon in seiner Frühzeit geographisch weit hinausreichte.
So weit geht der Wunsch nach Differenzierung, dass der Anschluss an die oft holzschnittartig geführten öffentlichen Debatten schwerfällt. Angesichts von Populisten, die auf Desinformation und Stereotype setzen, ist die Differenzierung umso wichtiger.
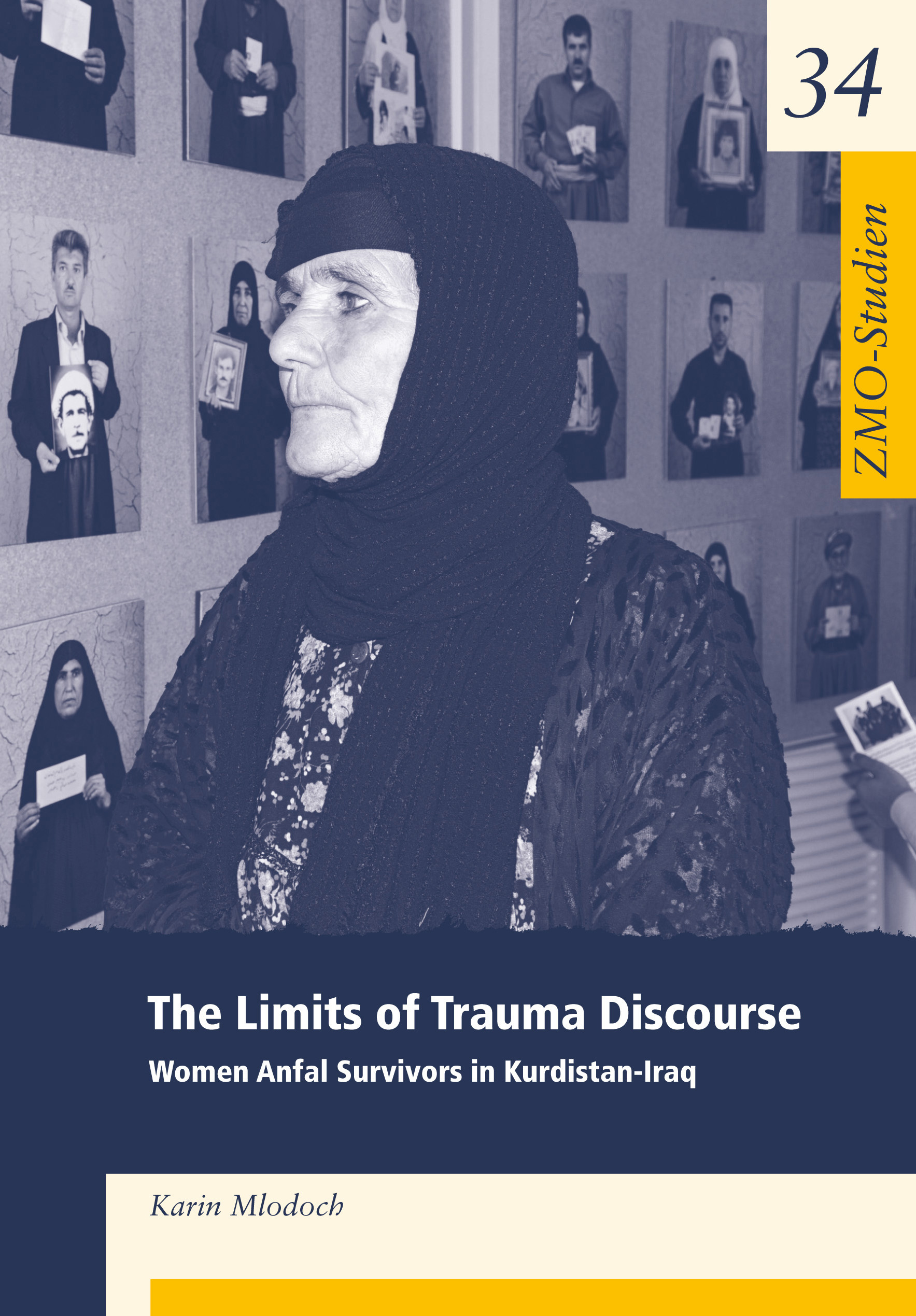
Aber im Differenzierungsnebel der eigenen Sprache und mit dem ständigen Gefühl, den komplexen Gegenständen nicht gerecht zu werden, droht das formulierte Ziel – über den Islam differenziert zu sprechen und dennoch in die öffentliche Debatte einzugreifen – auf der Strecke zu bleiben.
Den Elfenbeinturm verlassen
Für ihren Versuch zu differenzieren, werden Wissenschaftler nicht selten als „Islamversteher“ verunglimpft. Das ist deutlich negativ konnotiert, aber seit wann ist „verstehen“ eine negative Eigenschaft? Die Kritiker meinen damit, die Forscher zeigten Verständnis für einen Islam, den sie als per se intolerante und gewaltbereite politische Religion, oder, noch eher, als religiös verbrämte politische Ideologie bezeichnen.
Mit pauschaler Kritik an „dem Islam“ kann man in Europa derzeit nicht nur viele Wählerstimmen einfangen, sondern auch mehr Geld verdienen als je zuvor. Islamfeindliche Bücher wie Thilo Sarrazins „Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“ oder Hamed Abdel-Samads „Der islamische Faschismus. Eine Analyse“ stehen weit oben auf den Bestsellerlisten. Erklärende und differenzierende wissenschaftliche Bücher über den Islam wurden dort noch nicht gesichtet.
Angeblich sind die Medien schuld an der einseitigen Debatte. Aus Sicht der Islamkritiker, weil sie angeblich mit „falscher Toleranz“ über den Islam berichten; aus Sicht der Islamforscher, weil die Medien selbst viel zu oft stereotype Islambilder bedienen.
Dabei gibt es eine Menge Versuche im Journalismus, differenziert und sachlich zu berichten, während umgekehrt nur wenige Wissenschaftler im öffentlichen Diskurs vorkommen. Dafür müssten sie ihre Medienkompetenz verbessern und zum Beispiel dringend soziale Medien nutzen. Aber das ZMO, das immerhin mit Projekten, Ausstellungen oder Konzerten in die Öffentlichkeit geht, sucht man zum Beispiel auf Twitter bisher vergeblich.
Dabei wird am ZMO durchaus über aktuelle Themen diskutiert: Über die jüngsten Lokalwahlen in der Türkei oder die kommenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Tunesien zum Beispiel.
Aber im politischen und medialen Diskurs sind die Forscher nur selten präsent. Das kritisierte die Journalistin Charlotte Wiedemann auf der Podiumsdiskussion: „Ich würde mir wünschen, dass Wissenschaft öfter mal reingrätscht“, sagte sie. Es gebe viele Themen, die in der öffentlichen Debatte zwischen Krieg in Syrien und dem Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat völlig untergehen. Die politische Lage in Mali sei ein Beispiel.
Obwohl in Mali eine Bundeswehrmission im Einsatz ist, gibt es keine nennenswerte öffentliche Diskussion in Deutschland über die Frage, wie sich der Militäreinsatz auf das Leben der Menschen und die politische Lage im Land auswirkt.
Warum können Forscherinnen und Forscher, die zu Westafrika arbeiten, diese Lücke nicht füllen? Mali steht hier nur beispielhaft für viele andere Themen. Direkt mit dieser Frage konfrontiert, wiegeln die meisten Wissenschaftler ab. Es fehle die Zeit, der Veröffentlichungs- und Karrieredruck im hochkompetitiven Wissenschaftssystem sei extrem; und es fehle an Erfahrung und Kompetenz, um sich auf die notwendigen medialen Vereinfachungen einzulassen.
Dabei ist es für Journalisten im schnelllebigen Medienumfeld genauso schwierig, differenziert über komplexe Hintergründe zu berichten, wie für Wissenschaftler, die ihren Forschungsgegenstand in die öffentliche Debatte einbringen wollen.
Die Podiumsdiskussion in Berlin hat nicht nur gezeigt, wie klug und differenziert wissenschaftliche Arbeit sein kann. Sie hat auch gezeigt, wie groß der Nachholbedarf für ihre Vermittlung außerhalb des sprichwörtlichen Elfenbeinturms noch ist.
Wissenschaft bleibt zu oft unter sich, diskutiert im Differenzierungsnebel, während „draußen“ die Populisten Diskurshoheit beanspruchen. Höchste Zeit, dass Wissenschaftler öfter mal reingrätschten.
René Wildangel
© Qantara.de 2019