Geliebt und gehasst

Wie kaum ein anderer ist der Begriff „Willkommenskultur“ mit der Debatte über die hiesige Flüchtlingspolitik verbunden. Für die einen steht der Begriff für Weltoffenheit und Toleranz im Umgang mit Immigranten, den anderen dient er als Schimpfwort in ihrem Feldzug gegen die angeblich drohende Zersetzung der Nation. Heute ist jedoch vergessen, dass man hierzulande bereits ein ganzes Jahrzehnt vor der sogenannten Flüchtlingskrise der Jahre nach 2015 über Willkommenskultur zu debattieren begann.
Die Diskussion nahm ihren Anfang ursprünglich unter der von Klaus Wowereit geführten rot-roten Koalition (SPD/PDS) im Berliner Senat. Schon die Einführung des Terminus in den deutschen Diskurs war von einem Zwiespalt gekennzeichnet, der auch die spätere Debatte prägen sollte. Als nämlich 2004 die damalige Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner (PDS) erklärte, man wolle „eine neue Willkommenskultur entwickeln“, fühlte sich Berlins Innensenator Ehrhart Körting (SPD) bemüßigt, gleich klarzustellen, dass es auch künftig Abschiebungen bei illegalem Aufenthalt geben werde: „Es werden nicht alle bleiben können.“
Ein amtliches „Willkommenspaket“
Gemeint waren damals vor allem die schon länger in Berlin lediglich geduldeten palästinensischen und bosnischen Asylsuchenden. Als Orientierungshilfe für sie und andere Migranten gab Berlins Beauftragter für Integration und Migration, Günter Piening (2003 - 2012), ein Jahr später eine – wohl die erste – amtliche, in acht Sprachen verfasste, 80-seitige Broschüre als „Willkommenspaket“ für Zuwanderer heraus.
Piening, der heute im Gespräch betont, dass es damals bei dem neuen Willkommens-Kurs nicht so sehr um eintreffende, sondern vor allem um bereits in Berlin lebende Flüchtlinge ging, erntete mit seiner Initiative nicht nur Lob. Die oppositionellen Grünen, die die Schaffung einer „neuen Willkommenskultur“ zwar grundsätzlich begrüßten, kritisierten das Konzept des Senats. Es enthalte „viele schöne Worte, aber wenig Konkretes zur Umsetzung“ monierten sie. Als aber eine Berliner Schule kurz darauf ihre Schüler anhielt, nur Deutsch zu sprechen, machte der grüne Abgeordnete Özcan Mutlu den Terminus kurzerhand zum Kampfbegriff: Die schulische Maßnahme zeuge nicht von einer Willkommenskultur.
Über den Berliner Sprachstreit berichtete damals, Anfang 2006, auch schon die überregionale Presse, und schnell wurde der Begriff Willkommenskultur zum geflügelten Schlagwort. Als in jenem Jahr der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) den umstrittenen, als diskriminierend gegenüber Muslimen kritisierten Einbürgerungstest verteidigte, berief er sich auch darauf, dass im Land eine Willkommenskultur herrsche. Zugleich warnte er aber vor „Parallelgesellschaften“.
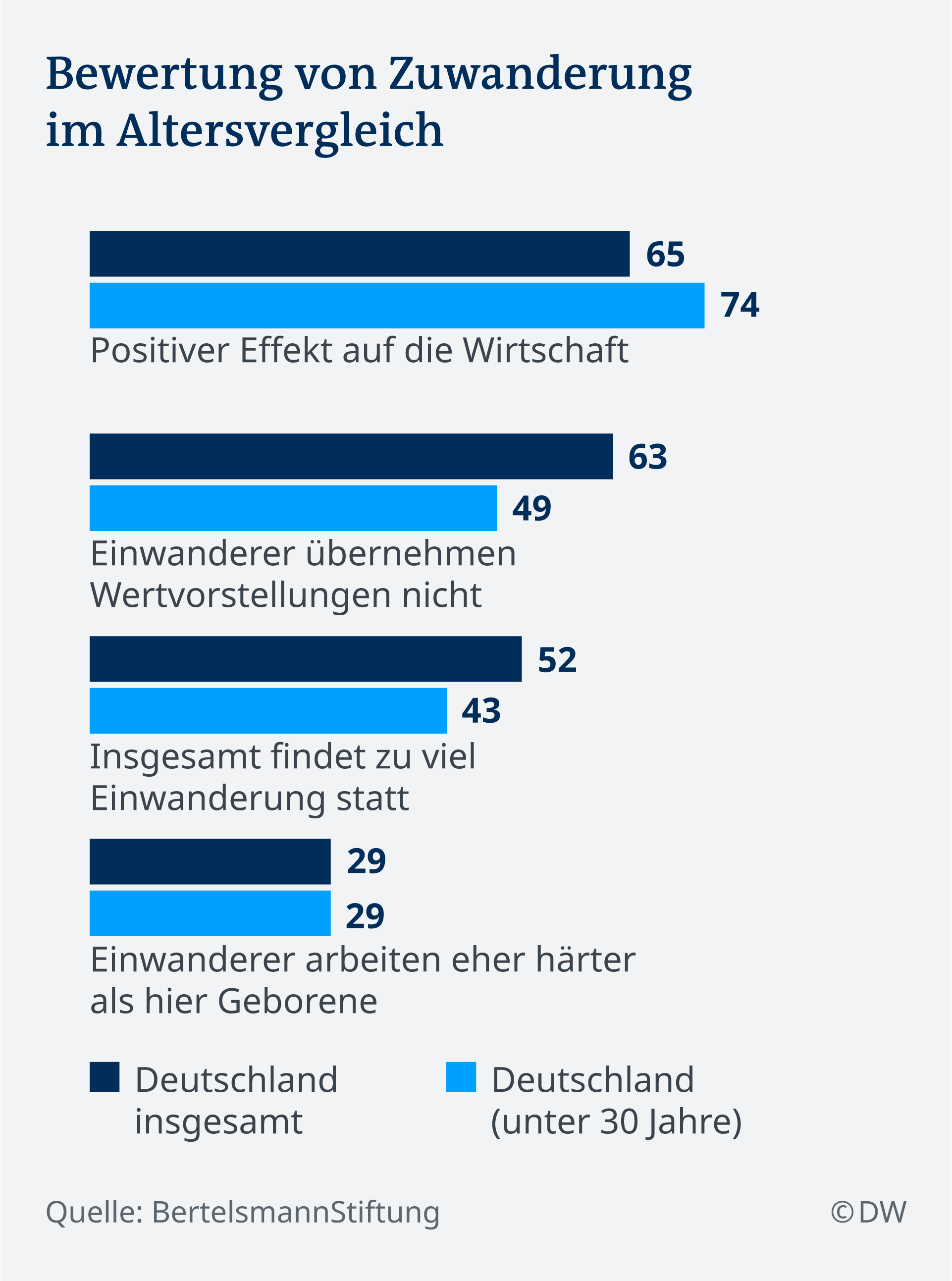
Gespaltenes Verhältnis zu muslimischen Migranten
Bereits damals schürte die rechtskonservative Presse Ressentiments gegen Muslime, indem sie den „Ehrenmord“ an der Deutsch-Kurdin Hatun Sürücü 2005 in Berlin für ihre Zwecke ausschlachtete.
Aus der Debatte über den Umgang mit Migranten wurde spätestens jetzt auch eine Diskussion über das eigene Verhältnis zu Muslimen, das schon damals gespalten war. So etwa forderte im Februar 2007 der Berliner CDU-Fraktionschef Friedbert Pflüger eine „neue Willkommenskultur gegenüber muslimischen Migranten“- Gleichzeitig lehnte er aber den Bau einer Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Pankow mit der Begründung ab, die Ahmadiyya ähnele einer Sekte. Das Gebetshaus wurde dennoch gebaut und ein Jahr später eröffnet.
In den folgenden Jahren wurde immer häufiger der Ruf nach einer „neuen Willkommenskultur“ laut – ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene. Als Antwort auf die Kritik an ihrer angeblich zu liberalen Einwanderungspolitik befürworteten nun manche Politiker nur noch eine Willkommenskultur für „qualifizierte Zuwanderer“. Andere hingegen wünschten sich ein „Willkommensklima“ und warfen den Medien vor, die Schaffung eines solchen Klimas durch ihre Konzentration auf Fälle von „Integrationsunwilligen“ zu erschweren.
Der Wunsch nach einer Willkommenskultur wurde übrigens schon zu Beginn der 2010er Jahre auch außerhalb des Kontexts Migration artikuliert. Eine Willkommenskultur, so etwa 2011 ein Kirchenvertreter aus Göppingen, bräuchte es „für Familien, die heute nicht mehr zwangsläufig von sich aus in die Kirchengemeinden kommen“.Die Gegner positionieren sich
Schon lange vor 2015 hatte es den Anschein, als würde die Leidenschaft der Deutschen und auch des deutschen Staates für eine eigene und – wie sie häufig genannt wurde – „echte“ Willkommenskultur immer weiterwachsen. Als das Bundeskabinett unter diesem Schlagwort im März 2011 den Entwurf für ein Gesetz zur Anerkennung ausländischer Berufs- und Studienabschlüsse verabschiedete, feierte manches Blatt dies mit dem Titel: „Neues Gesetz zur Willkommenskultur“.
[embed:render:embedded:node:18769]
Doch je selbstbewusster die Vertreter einer Willkommenskultur auftraten, desto entschiedener positionierten sich in der damals noch „Integrationsdebatte“ genannten Diskussion ihre Gegner. Immer wieder arbeiteten sie dabei auch mit dem schon zuvor wirkungsvollen Verweis auf einen drohenden „Missbrauch des Rechtsstaates durch muslimische Migranten“.
Die Volksparteien reagierten prompt und machten sich 2013 allesamt in ihren Wahlprogrammen für die Willkommenskultur stark. Die CDU warb mit dem Slogan „Vielfalt bereichert – Willkommenskultur schaffen“ und pries Deutschland als erfolgreiches Integrationsland“. Gleichzeitig trat sie der „Abschottung in Parallelgesellschaften und islamischen Sondergerichten außerhalb unserer Rechtsordnung“ mit Entschiedenheit entgegen. Die SPD forderte eine Willkommenskultur, die an eine „Teilhabestruktur“ gekoppelt ist, und plädierte dafür, die „Ausländerbehörden zu Willkommensbehörden“ weiterzuentwickeln.
Letztere waren gewissermaßen schon im Entstehen begriffen, als die AfD 2014 in ihrem Wahlkampf in Sachsen gegen die „Kampagnen für Weltoffenheit oder gar Antidiskriminierungsschulungen“ der Landesregierung wetterte. Sie geißelte die Kampagnen als fehlgeschlagene Maßnahmen zur „Vorbeugung von Parallelgesellschaften“. Als sie stattdessen unter anderem „eine an die Einwanderer gerichtete aktivierende Integrationspolitik“ forderte und im gleichen Atemzug gegen „Moscheebauten mit Minaretten“ mobilisierte, gewann sie auf Anhieb jene für viele damals schockierenden 9,7 Prozent der Stimmen. Nur wenige Monate später, im Dezember 2014, gehörten in Dresden bei Demonstrationen von Pegida-Anhängern und -Gegnern die Rufe für und wider die Willkommenskultur fest zum rhetorischen Straßenkampf.
Höhepunkt der Willkommenskultur im August 2015
Das warmherzige Willkommenheißen der aus Ungarn in deutschen Bahnhöfen eintreffenden Flüchtlinge am 30. August 2015 und in den Tagen war nur eine weitere Etappe in einem schon länger schwelenden Konflikt um die Willkommenskultur, was aber längst vergessen ist. Ebenso, dass für deren Befürworter trotz des damaligen medialen Hypes die Schlacht keineswegs gewonnen schien. So sah sich der Münchner Stadtrat schon am 9. September veranlasst, die Resolution „Willkommenskultur in München“ zu verabschieden.
Wie viele Stadt- und Gemeinderäte sowie Ortsverbände verschiedener Parteien anschließend ähnliche Beschlüsse fassten, ist nicht dokumentiert. Es dürften aber nicht wenige gewesen sein, denn die Gemeindeverwaltungen standen damals längst hinter den zahlreichen Flüchtlingshelferkreisen und unterstützten sie nach Möglichkeit auf vielfältige Weise.

Entsprechend wuchs mit der Zeit auch das Angebot an „Schulungen in Willkommenskultur“ für Gemeindemitarbeiter, woraus inzwischen ein eigener – auch jenseits der Flüchtlingsarbeit – expandierender Wirtschaftszweig geworden ist. Unter dem Stichwort Willkommenskultur wurden bald alle möglichen Aktivitäten subsumiert: Schon 2016 gab es in Bamberg „Willkommenspakete für Neugeborene“ und die Stadt Beelitz in Brandenburg startete im Jahr darauf einen „Babywillkommensdienst“. Enorm gewachsen ist seit etwa vier Jahren die publizistische wie auch wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Terminus Willkommenskultur und seiner Rezeption in Deutschland. Für das Thema interessieren sich auch im Ausland immer mehr Forscher.
In der hiesigen Parteipolitik zeigt sich indes ein anderer Trend. CDU/CSU, SPD und FDP warben vor der Bundestagswahl 2017 nicht mehr für eine Willkommenskultur. Die Union warnte ähnlich wie die AfD – und genau wie schon 2014 die NPD in Sachsen – ausdrücklich vor „Multi-Kulti“. Die Grünen konstatierten realitätsnah, aber gleichzeitig geschichtsvergessen, besorgt: „Nach einem Jahr Willkommenskultur gibt sie zunehmend rechten Stimmungen nach“. Die Linke bekannte sich dazu, „Teil der Willkommens- und Solidaritätsbewegung für die Geflüchteten“ zu sein. Explizit eine „Willkommenskultur“ forderte damals im Übrigen als einzige Partei die AfD. So war Kapitel sieben ihres Wahlprogramms, das gleich auf den alarmistischen Abschnitt über den Islam folgte, überschrieben mit „Willkommenskultur für Kinder: Familienförderung und Bevölkerungsentwicklung“ – das bevorzugte Rezept der AfD gegen die „Schrumpfung unserer angestammten Bevölkerung“.
Auch wenn die Kritik an der Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen gewachsen ist, so wird sie doch von der engagierten deutschen Zivilgesellschaft nach wie vor ungebrochen praktiziert. Belege dafür finden sich leicht, wenn man nur danach suchen will.
© Qantara.de 2020
Joseph Croitoru ist promovierter Historiker und freier Journalist. Er studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Judaistik in Jerusalem und Freiburg. Sein Buch "Die Deutschen und der Orient: Faszination, Verachtung und die Widersprüche der Aufklärung" ist beim Carl Hanser Verlag 2018 erschienen und wird derzeit ins Arabische übersetzt. Bei C.H. Beck erscheint am 22. Februar 2021 sein Buch "Al-Aqsa oder Tempelberg. Der ewige Kampf um Jerusalems heilige Stätten".